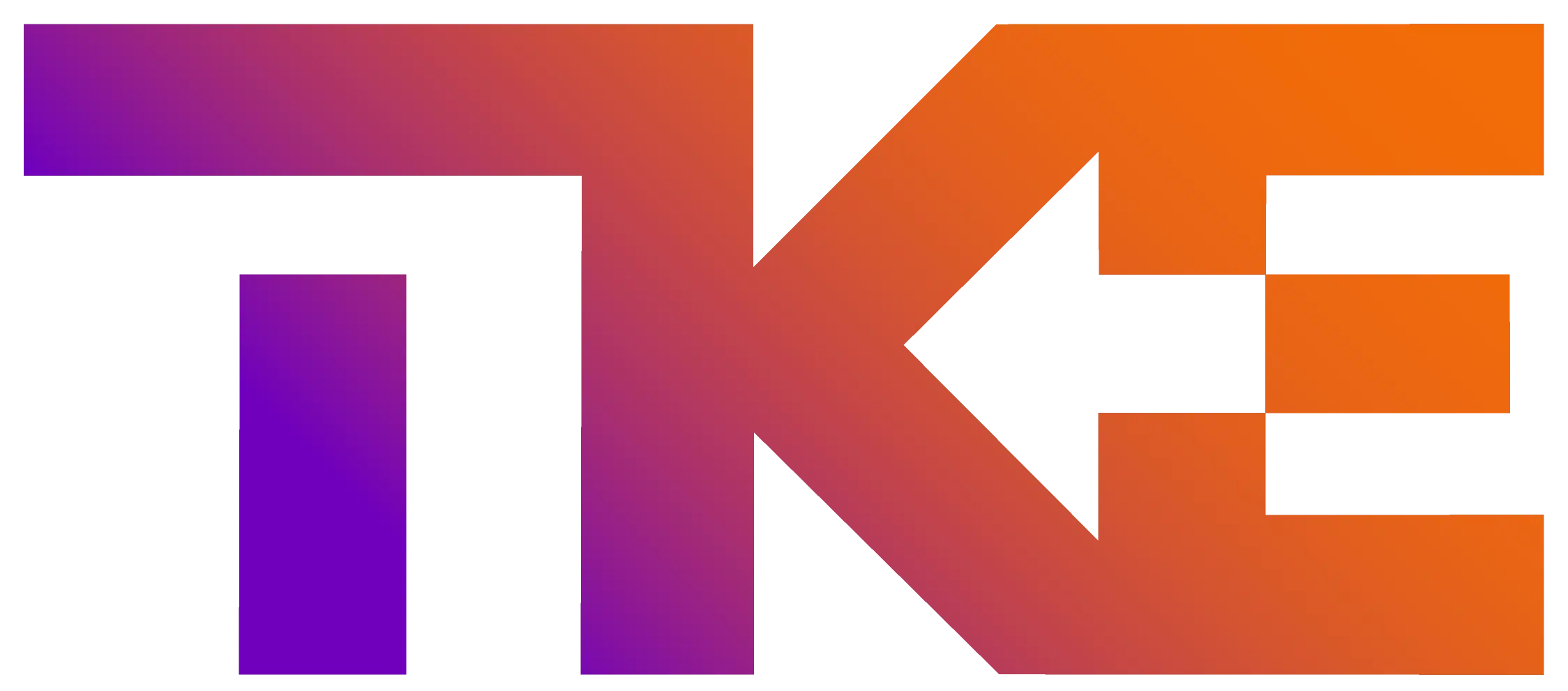Was ist der graue Star?
Der graue Star wird in der Medizin auch als Katarakt bezeichnet und beschreibt eine sehr häufig vorkommende Augenerkrankung, die meist angeboren ist oder sich im Laufe des Lebens entwickelt – oftmals erst im Alter. Die Erkrankung tritt überwiegend nach dem 60. Lebensjahr auf (sogenannter „Altersstar“) und ist somit die häufigste Augenerkrankung bei älteren Menschen. Sie macht sich durch eine Trübung der Augenlinse bemerkbar und ist bei Menschen, die bereits an einem weit entwickelten grauen Star leiden, in der Regel durch eine graue Farbe hinter der Pupille sichtbar. Aufgrund dieser gräulichen Farbe kam es auch zum Namen "grauer Star".
Grauer Star im Alter: Was sind die Ursachen?
Bei gesunden Menschen ist die Linse durchsichtig sowie weich und flexibel, sodass die Augenmuskeln die Linse verformen können. Diese Flexibilität nimmt im höheren Alter jedoch ab. Im Laufe der Zeit verändert sich auch die Zusammensetzung der Linsenflüssigkeit, die die oben genannten Eigenschaften der Linse beeinflusst. Die Flüssigkeitsmenge in der Linse nimmt zu, bestimmte Stoffwechselprozesse der Linse können nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Linse quillt auf. Dies führt zur Linsentrübung und somit zum Altersstar.
Andere Ursachen können sein:
- Augenverletzungen (z. B. Prellung des Augapfels durch einen Faustschlag)
- Zuckerkrankheit
- UV-Licht und Mangelernährung
Angeboren werden kann der graue Star, wenn es zu Schädigungen während der Schwangerschaft gekommen ist, beispielsweise aufgrund von hohem Alkoholkonsum oder infolge von einer Rötel-Infektion während der Schwangerschaft.
Was sind die Symptome des Altersstar?
Der Grauer Star im Alter kennzeichnet sich durch einen langsamen und schmerzfreien Verlust der Sehschärfe aus. Egal, ob aus der Nähe oder Ferne, die Sehschärfe nimmt stark ab. Dadurch erscheinen den Betroffenen Farben trüber – so als würden sie das Gesehene umgeben von Nebel wahrnehmen.
Darüber hinaus kann es auch zum Auftreten von Doppelbildern und Kontrastverlust kommen. Das räumliche Sehen wird eingeschränkt und die Anpassung des Auges an Hell und Dunkel verschlechtert sich ebenfalls. Darüberhinaus kommt es beim Altersstar oft zu erhöhter Blendempfindlichkeit, Die genauen Altersstar Symptome hängen vom Stadium der Linsentrübung ab und welche Bereiche der Linse betroffen sind. Dabei wird unterschieden zwischen:
Altersstar: Welchen Formen gibt es?
- Rindentrübung oder Rindenstar beim grauen Star:
Die Augenlinse besteht aus Rinde und Kern. Beim Rindenstar ist der äußere Bereich der Linse, die Rinde, von der Trübung betroffen. Es bilden sich sogenannte Wasserspalten zwischen den zerfallenden Fasernbündeln der Rinde, die zu gräulich-weißen Trübungen der Linse werden können. Der Rindenstar führt sowohl bei der Nah- als auch der Fernsicht zu Problemen und macht sich mit verstärkter Blendeempfindlichkeit bemerkbar.
- Kerntrübung beim grauen Star:
Bei der Kerntrübung, auch Kernstar genannt, verhärtet sich mit und mit der Linsenkern. Es kommt zu einer sich langsam entwickelnden gelb-bräunlichen Trübung der Linse und zu einer Zunahme der Brechkraft des verhärteten Linsenkerns. Dadurch entwickelt sich beim Kernstar oftmals eine Kurzsichtigkeit, was die Weitsicht stärker einschränkt als das nahe Lesen.
- Hintere Schalentrübung beim grauen Star:
Bei Altersstar Erkrankten mit dieser Trübungsart setzt die Trübung in der hinteren Linsenkapsel auf. Die Eintrübung schreitet schnell foran und führt zu Sehstörungen, vor allem bei Nahsicht. Nahe gelegene Objekte werden bedeutend schlechter gesehen als entfernte Objekte.
Kostenloses Infopaket anfordern

Ja, ich wünsche das individuell zusammengestellte Infopaket und möchte hierfür eine kostenfreie telefonische Beratung.
Wie wird der graue Star diagnostiziert?
Die Diagnose des grauen Stars liegt in der Verantwortung des Augenarztes. Ein ausgiebiges Gespräch mit dem Patienten gibt Aufschluss über das entsprechende Krankheitsbild. Anschließend wird das Sehvermögen des Betroffenen untersucht, um zu schauen wie stark und warum das Sehen eingeschränkt ist. Hierfür gibt es eine Reihe von Verfahren, die der Augenarzt anwenden kann. Meistens werden dem Betroffenen Augentropfen gegeben, die die Pupille weiten, so ist eine genauere Untersuchung gewährleistet. Die am meisten verwendeten Verfahren sind folgende:
- Diagnose mit dem Spaltlampenmikroskop (umgangssprachlich auch einfach als Spaltlampe bezeichnet): Das Spaltlampenmikroskop ist ein Lichtmikroskop, mit dem das Auge sowohl vergrößert als auch beleuchtet und ausgiebig untersucht werden kann. Der Patient sitzt bei der Untersuchung vor dem Gerät, Kinn und Stirn werden abgestützt, anschließend bringt der Augenarzt die Geräteoptik in Position. Der Lichtstrahl kann die durchsichtigen Augenpartien untersuchen. Dadurch kann vom Arzt auch die Netzhaut am HIntergrund des Auges untersucht werden.
- Brückner-Test: Auch hier wird das Auge so durchleuchtet, dass der Augenarzt Trübungen auf der Netzhaut erkennen kann.
- Hornhautuntersuchungen: Als ergänzende Untersuchung kann der Augenarzt auch die Hornhaut des Betroffenen messen, um zu sehen, ob diese gleichermaßen gekrümmt ist. Außerdem wird peprüft, ob die Zellschicht, welche für die Versorgung der Hornhaut zuständig ist, in Ordnung ist.
Behandlung des grauen Stars im Alter
Der Altersstar ist nicht mit Medikamenten zu behandeln. Die einzige Behandlungsmöglichkeit ist ein operativer Linsentausch. Er dauert durchschnittlich rund 30 Minuten. Die grauer Star Operation zählt mittlerweile zu den am häufigsten durchgeführten Operationen in Deutschland. Bei 90 bis 95 Prozent der Betroffenen bessert sich das Sehvermögen nach dem Eingriff deutlich, insbesondere dann, wenn das Auge nicht anderweitig erkrankt ist. Jeder Betroffene muss nach Rücksprache mit dem Augenarzt individuell entscheiden, ob eine Operation des grauen Stars infrage kommt oder nicht. Ausschlaggebendes Kriterium ist mit Sicherheit, wie stark der Patient durch die verminderte Sehstärke beeinträchtigt ist. Dennoch sollte immer bedacht werden, dass generell die Wiederherstellung beziehungsweise Verbesserung des Sehvermögens die Lebensqualität erheblich verbessern kann.
Bei der grauen Star Operation wird die trübe Linse durch eine Kunstlinse aus Acryl oder Silikon ersetzt. Hier hat der Erkrankte die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Linsentypen zu entscheiden, nämlich der Monofokallinse und der Multifokallinse. Erstere besitzt einen Brennpunkt, sie ermöglicht eine Verbesserung des Sehens entweder aus der Ferne oder aus der Nähe. Sie kann also nicht die gesamte Sehschwäche korrigieren und der grauer Star Erkrankte wird wahrscheinlich weiterhin eine Sehbrille benötigen.
Die Multifokallinse kann im Gegensatz zur Monofokallinse, den grauen Star in der Regel vollständig beseitigen und alle Sehschwächen – egal ob aus der Nähe oder aus der Ferne – korrigieren. Die künstliche Linse ermöglicht demnach meistens ein Leben ganz ohne Brille. Die Multifokallinse hat gegenüber der Monofokallinse den entscheidenden Vorteil, dass sie mit mehreren Brennpunkten arbeitet.
Für den Eingriff genügt eine örtliche Betäubung. Operiert wird zunächst ein Auge, vorzugsweise das stärker vom grauen Star betroffene Auge. Das zweite folgt nach OP Plan etwas später. Die Behandlung wird heute vielfach ambulant durchgeführt, das heißt, dass der Altersstar-Betroffene nach der Operation mit Begleitung nach Hause darf. Anschließend heißt es: eine umfassende Nachsorge. Das behandelte Auge sollte nach dem Eingriff vom Arzt für einige Monate unter Beobachtung sein und örtlich mit Antibiotika – in Form von Augentropfen – versorgt werden. Im Normalfall kann die Linse auf Lebenszeit im Auge bleiben.
Es ist immer ratsam den Arzt aufzusuchen und sich professionell diagnostizieren und beraten zu lassen, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas mit Ihren Augen nicht in Ordnung ist. Dringend notwendig ist dies, wenn sich Ihr Sehvermögen mit den Jahren drastisch verschlechtert, Sie Schmerzen in Form von starkem Brennen oder Druck im Auge verspüren und Ihr Auge beginnt zu röten. Auch wenn Sie einen störenden Fleck vor Ihrem Auge haben oder Mückenschwärme wahrnehmen, sollten Sie umgehend den entsprechenden Facharzt aufzusuchen.
Haftungsausschluss und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen: Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch können die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt Ihres Vertrauens!