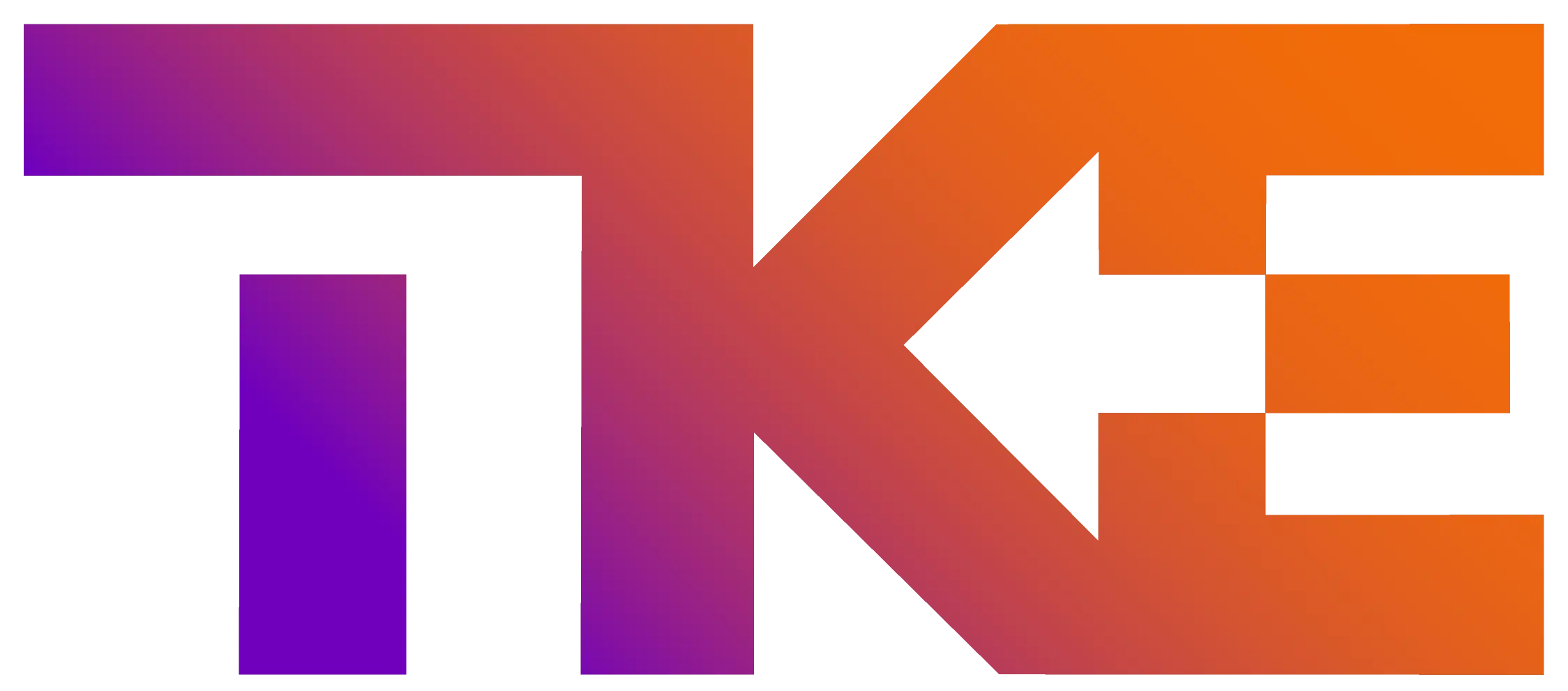Bei einer Sehbehinderung handelt es sich um eine teils erhebliche Einschränkung des Sehvermögens. Naturgemäß bedeutet das eine Herausforderung im Alltag. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die mehrheitlich auf Menschen ohne körperliche Behinderungen ausgerichtet ist. Dementsprechend machen sich für sehbehinderte Menschen Hindernisse unterschiedlicher Art und Größe bemerkbar. Dabei geht es oftmals um alltägliche Aktivitäten. Das Fernsehen ist ein Beispiel dafür. Doch es gibt Optionen, sehbehinderten und blinden Menschen den Zugang zu Medien wie diesem zu ermöglichen.
Ab wann sprechen wir von einer Sehbehinderung?
Oft kommt die Frage auf: Wann sprechen wir von einer Sehbehinderung? Schwerbehindertenausweise gibt es erst ab einer bestimmten Sehschwäche. Bei eingeschränktem Sehvermögen liegt nicht automatisch eine Sehbehinderung vor. Kurz- und Weitsichtigkeit gehören nicht dazu. Denn diese Sehstörungen lassen sich leicht korrigieren, beispielsweise mit Brillen oder Kontaktlinsen. Bei einer Sehbehinderung ist das nicht der Fall. Zum einen ist das Sehvermögen hier deutlich stärker eingeschränkt. Zum anderen erfordern Sehbehinderungen – falls behandelbar – operative Eingriffe. Bestimmte Arten von Sehbehinderungen können vorübergehend auftreten, beispielsweise infolge einer Erkrankung.
Bei Sehbehinderungen existieren verschiedene Abstufungen bis hin zur Blindheit. Grundlegend liegt eine Sehbehinderung vor, wenn das Sehvermögen unter 30 Prozent liegt, gemessen an einem normalen Sehvermögen. Und zwar auch dann, wenn Betroffene eine Brille oder Kontaktlinsen zur Hilfe nehmen. Hier wird die Sehbehinderung auf einem Auge, dem besser sehenden, als Maßstab genommen. Als hochgradig sehbehindert gelten Menschen mit einem Sehvermögen von maximal fünf Prozent. Erreicht es nicht mehr als zwei Prozent, gilt die Person als blind.
Fernsehen mit dem passenden TV-Gerät
Spezielle Fernseher für Sehbehinderte gibt es nicht. Allerdings existieren viele Modelle verschiedener Hersteller, die eine sogenannte Sprachausgabe haben. Wie umfassend diese eingerichtet wurde, variiert je nach Gerät. So ist es beispielsweise leider noch nicht möglich, die Ersteinrichtung mithilfe einer Sprachausgabe vorzunehmen. Hier braucht es die Unterstützung einer sehenden Person, um den Fernseher selbstständig bedienen zu können.
Nach der Ersteinrichtung lässt sich das TV-Gerät unterschiedlich flexibel bedienen. Bei vielen Modellen reicht beispielsweise ein Knopfdruck, um eine Tonspur für das Programm zu aktivieren. Wie Hersteller bei ihren Geräten barrierefreie Funktionen umsetzen, ist letztlich individuell. Neben dem Empfang von Audiodeskriptionen für Menschen mit Sehbehinderung gibt es weitere Optionen. Das umschließt beispielsweise Menüführungen oder elektronische Programmzeitschriften, die sich Nutzer vorlesen lassen können.
Bei der Auswahl des passenden TV-Geräts kommt es auf die explizite Beschreibung an. Modelle, die die Bezeichnung "sprechender Fernseher" oder die Kennzeichnung "mit Sprachfunktion" tragen, sind die richtige Wahl. Es kommt demnach beim Fernsehen grundlegend auf die richtige Unterstützung an, um entsprechende Bewegungsfreiheit zu gewährleisten – ähnlich wie bei einem Treppenlift.
Die Audiodeskription
Audiodeskription ist das Mittel, um Fernsehen für Blinde und Sehbehinderte zu gestalten. Diese Technik beschränkt sich nicht auf Fernsehgeräte. Sie gehört auch zu Kino und Theater dazu. Bei der Audiodeskription beschreibt eine Stimme das Geschehen, das beispielsweise bei einem Film stattfindet. Diese separate Tonspur setzt üblicherweise ein, wenn keine der handelnden Personen spricht oder es auch sonst keine Geräusche gibt, die die Handlung eindeutig erkennen lassen. Es geht um das Geschehen, das regulär Beobachtung erfordert.
Beim Fernsehen oder Kino lässt sich diese Audiodeskription zuschalten. In speziellen Vorstellungen von Theatern oder Opernhäusern gibt es eine Live-Beschreibung des Geschehens, das auf der Bühne stattfindet. Bei der Audiodeskription für das Fernsehen handelt es sich um eine digital via Fernsehgerät oder Receiver gesendete Tonspur. Über die jeweiligen Einstellungen lässt sie sich separat zuschalten.
Bei der Audiodeskription handelt es sich inzwischen um weit mehr als einen zusätzlichen Service. Das Angebot folgt auch einer von der EU 2018 beschlossenen Richtlinie, um den Zugang zum Medium zu verbessern. Das zielt nicht nur auf sehbehinderte und blinde Menschen ab. Auch hörbehinderte Personen sollen davon profitieren. Die Ausweitung von Untertiteln und Gebärdensprache geht dahingehend einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit.
Hörfilme und weitere Angebote für sehbehinderte und blinde Menschen
Fernsehen für Menschen mit Sehbehinderung ist über das aktuell laufende Programm möglich. Darüber hinaus bieten viele Sender über ihre Mediatheken ein entsprechendes Angebot an, um Sendungen, Filme und Serien zu genießen. Der Fokus liegt dabei vielfach auf erfolgreichen Sendeformaten, also solchen, die mit guten Quoten verbunden sind.

Im Vergleich bieten die öffentlich-rechtlichen Sender bislang das größte Angebot an barrierefreiem Fernsehen. Bei privaten Sendern gibt es die Möglichkeit der Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderung noch eher vereinzelt. Als Grund werden beispielsweise fehlende Finanzierungsmöglichkeiten angegeben.
Was externe Apps für das Fernsehen leisten
Neben dem regulären Angebot für Audiodeskription gibt es für Menschen mit Sehbehinderung die Möglichkeit, Apps für Audiodeskription zu nutzen. Diese stammen teils von den Sendeanstalten selbst, teils von externen Anbietern. Hier drei populäre Beispiele:
- GRETA: kostenlose App für Audiodeskription und Untertitel. Lässt sich via Smartphone und mit Kopfhörern parallel zuschalten. Wachsendes Angebot an Filmen. Produzenten und Verleiher entscheiden, welche Filme sie barrierefrei zugänglich machen.
- BR Audiodeskription: App des Bayerischen Rundfunks, die eine Audiodeskription für ausgewählte Sendungen im BR-Fernsehen ermöglicht.
- MDR Audio: App des Mitteldeutschen Rundfunks. Audio-Angebote für blinde, sehbehinderte und voll sehende Nutzer. Livestream für die MDR-Hörfunkprogramme. Zusätzlich Wetter- und Verkehrsinformationen sowie ausgewählte Filme via App.
Neben diesen Angeboten stellen auch einige Privatsender Audiodeskriptionen via App zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Sat.1 oder Pro Sieben. Weitere Angebote ermöglichen keinen Zugang zur Audiodeskription, erleichtern aber beispielsweise das selbstständige Bedienen von Fernsehgeräten. Ein Beispiel hierfür ist die App TapTapSee. Sie richtet sich gezielt an Menschen mit Sehbehinderung oder Erblindung. Sie hilft dabei, Objekte zu identifizieren. Mittels Tippen machen Nutzer ein Foto. Die App liefert dann eine akustische Beschreibung dessen, was darauf zu sehen ist.
Fazit: Barrieren beim Fernsehen abbauen
Technik in Form moderner Audiodeskription ermöglicht sehbehinderten und blinden Menschen den Zugang zum Fernsehen. Das bisherige Angebot zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt, das Angebot auszubauen. Das bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Sehbehinderung, sondern auch auf jene mit eingeschränktem oder fehlendem Hörvermögen. Hinzu kommt der Zugang in leichter und einfacher Sprache, beispielsweise für Personen mit Lernschwierigkeiten.
Trotz langsamer Entwicklung gibt es Grund, optimistisch zu sein. Das liegt zum einen am barrierefreien Ausbau der Hersteller von Fernsehgeräten. Zum anderen an den zunehmenden Angeboten der Sendeanstalten. Zur regulären Audiodeskription kommen moderne Apps hinzu, die ein umfangreiches Fernseh- und Kinoerlebnis bieten sollen. Dementsprechend dürfte das Angebot in Zukunft weiter wachsen und Einschränkungen beim Fernsehen weniger werden.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Fernsehen mit Sehbehinderung
Welche Arten von Sehbehinderung gibt es?
Welche Erkrankungen können eine Sehbehinderung verursachen?
Wie ist es, sehbehindert zu sein?
Wie unterstützt man Menschen mit einer Sehbehinderung?
Kostenloses Infopaket anfordern

Ja, ich wünsche das individuell zusammengestellte Infopaket und möchte hierfür eine kostenfreie telefonische Beratung.